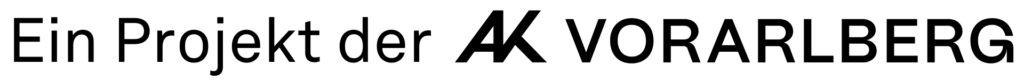Ankathie Koi über Burnout, Selbstfürsorge und die Bedeutung von Feminismus in der Musikbranche. Die Künstlerin spricht im Interview über ihre Erfahrungen mit den Schattenseiten des Tourlebens und darüber, wie sie gelernt hat, besser auf sich zu achten.
Ankathie, du bist dafür bekannt, auf der Bühne alles zu geben – manchmal sogar mehr als 100 Prozent…
Ankathie Koi: (lacht) Manchmal auch 120 Prozent.
Du hast in der Vergangenheit über deine Erfahrungen mit Burnout-Symptomen gesprochen. Wie gehst du heute damit um?
Ankathie Koi: Self-Care ist mittlerweile das A und O, besonders auf Tour. Das betrifft die Auswahl der Auftritte, die Häufigkeit der Shows und wie wir touren. 2018 war besonders hart: Wir waren mit klapprigen Bussen unterwegs und noch sehr im Rock’n’Roll-Lifestyle verhaftet. Die ersten Anzeichen des Burnouts zeigten sich darin, dass ich nicht mehr telefonieren konnte – das ist wohl ein typisches Symptom für mentale Überlastung. Heute finden wir eine bessere Balance: Wir sind zwar nicht die Ersten, die den Backstagebereich verlassen, aber auch nicht mehr die Letzten.
Als exzentrische Künstlerin wirst du vermutlich anders wahrgenommen als männliche Kollegen?
Ankathie Koi: Definitiv. Aber ich habe viele weibliche Fans zwischen 25 und 55, die diese „Fuck-it-Attitude“ sehr schätzen. Ich fühle mich sexy und kleide mich entsprechend, aber es hat auch etwas Groteskes. Ich glaube, Frauen nehmen das als Befreiung von gewissen Beauty-Standards wahr. Es gibt viele Leute, die mich zu viel finden – aber das ist mir egal. Entweder ich komme so an, wie ich bin, oder eben nicht.
Was wünschst du dir im Bereich Feminismus für die Zukunft?
Ankathie Koi: Der Gender Pay Gap muss endlich ernsthaft angegangen werden. Auch die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit ist noch ein großes Problem – selbst bei emanzipierten Frauen. Als Künstlerin bin ich zwar keine Aktivistin, aber ich spreche diese Themen auf der Bühne an. Es gibt keine benachteiligtere Gruppe als alleinerziehende Frauen, die schlecht bezahlte Jobs haben und ihre Wohnung kaum bezahlen können. Wenn auf einem unserer Konzerte auch nur eine von ihnen anfängt, Dinge zu hinterfragen und nicht länger hinzunehmen, dann haben wir schon etwas erreicht. Kleine Steine können eine Lawine auslösen.
Gibt es für dich überhaupt eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit?
Ankathie Koi: Das ist tatsächlich schwierig, weil dieser Job Leidenschaft mit Geldverdienen vermischt. Man vermarktet sich selbst als Produkt und ist sein:e eigene:r strengste:r Kritiker:in. Das macht es manchmal verhängnisvoll, aber die positiven Momente geben einem auch unfassbar viel Energie zurück. Ich bin ein Mensch der Extreme – entweder ganz heiß oder eiskalt – und arbeite noch daran, eine goldene Mitte zu finden.
Deine Kostüme sind für ihre Exzentrik bekannt. Woher holst du deine Inspiration?
Ankathie Koi: Meine musikalischen Wurzeln liegen in den 60er und 70er Jahren – von Jazz über Rock’n’Roll bis zum frühen Punk. Künstlerinnen wie Tina Turner oder Debbie Harry von Blondie haben mich stark beeinflusst. Diese unfassbare Spielfreude und Leidenschaft, die sie auf der Bühne zeigen, hat mich schon immer fasziniert. Ich mag Performer:innen, die exzentrisch sind und sich trauen, anders zu sein. Mittlerweile habe ich ein Set, bei dem ich mich auf jeden einzelnen Song freue und jeder Song mich kickt.
Böse Zungen behaupten ja, Musik sei keine richtige Arbeit. Was entgegnest du dem?
Ankathie Koi: Das ist nicht nur körperlich und emotional Schwerstarbeit, sondern oft auch schlecht bezahlt. Die Menschen haben Glück, dass Musiker:innen so passioniert sind – stellt euch mal vor, alle Radios blieben stumm! Was würden die Leute bei Hochzeiten, beim Training oder in Clubs machen? Die meisten meiner Freund:innen haben nebenbei noch Jobs, auch in größeren Bands. Nur bei den ganz Großen läuft es finanziell wirklich gut. Diese Arbeit verdient mehr Anerkennung.